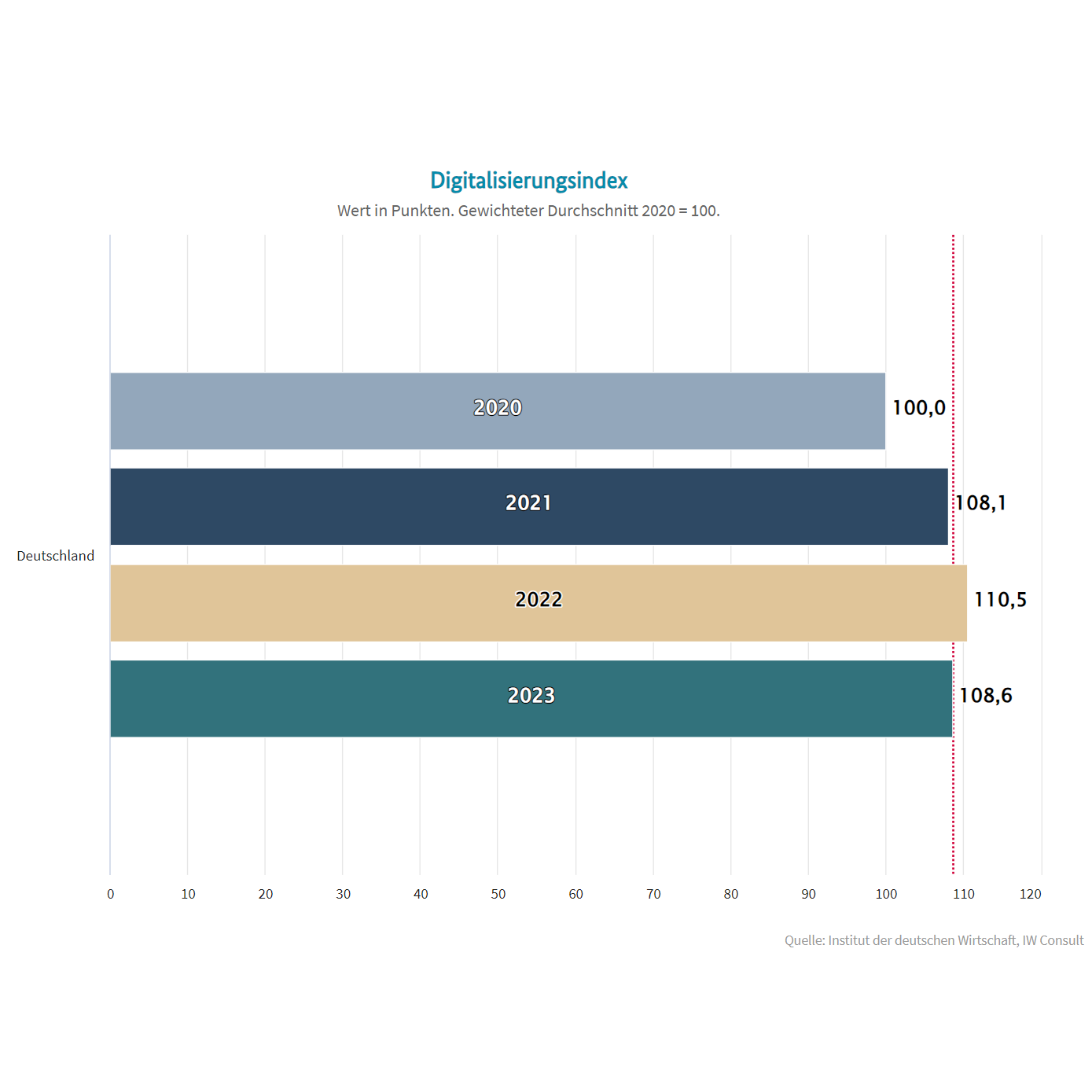© BMWK / Reitz
Schlüsseltechnologie des Jahrhunderts, die wie die Elektrizität ganze Industrien umwälzt, prognostizieren die einen, Job- und Kontrollverluste fürchten die anderen. Kaum eine innovative Entwicklung wird so kontrovers diskutiert wie Künstliche Intelligenz (KI). Dabei ist sie schon längst in unserem Alltag angekommen: Sprachassistenten im Smartphone beruhen ebenso auf KI wie Navigationssysteme, die nur dank dieser Technologie den täglichen Arbeitsweg als solchen erkennen und proaktiv eine schnellere Route vorschlagen können. Das hat weniger mit Science-Fiction zu tun als mit der Fähigkeit von Systemen, große Datenmengen anzunehmen, über programmierte Deep-Learning-Algorithmen daraus Schlüsse zu ziehen, Probleme zu lösen und zu lernen. „Solche Maschinen helfen uns dabei, die Fähigkeiten des Menschen zu verbessern und Fehler zu vermeiden. Denken Sie in etwa an selbstfahrende LKW, die keine Auffahrunfälle mehr verursachen, weil der Bremsassistent nicht müde wird“, so Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft kürzlich in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).
Vor allem für Wirtschaft und Produktion birgt die rasch voranschreitenden Entwicklung intelligenter Technologien immense Möglichkeiten. Um bis zu 25 Prozent jährlich wächst der globale Markt für KI-basierte Dienstleistungen, Software und Hardware – auf rund 130 Milliarden Dollar bis 2025, prognostiziert McKinsey in einer aktuellen Studie. Weltweit springen Unternehmen auf den Zug auf: Konzerne wie Google, Apple und Alibaba geben viele Milliarden aus, um in Sachen KI voranzukommen: 2016 gaben sie zwischen 20 und 30 Milliarden Euro für entsprechende Investitionen und Forschungen aus, so McKinsey in einer anderen Studie. Chinas Technologieminister Wan Gang kündigte unlängst einen nationalen KI-Plan an.
Auch in der deutschen Wirtschaft sorgen die Schlagworte Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für Aufbruchsstimmung: Rund 90 Prozent der deutschen Manager wollen in den nächsten Jahren KI-Strategien entwickeln, um global konkurrenzfähig zu bleiben, berichtet das Handelsblatt unter Bezug auf eine Studie von Wakefield Research. Und die Forscher von McKinsey prognostizieren bis 2030 ein bis zu vier Prozent höheres Bruttoinlandsprodukt durch den Einsatz von intelligenten Robotern. „Künstliche Intelligenz wird zum Wachstumsmotor für die deutsche Industrie“, heißt es in der Studie.
Manche fürchten, dass diese Entwicklung etliche Arbeitsplätze überflüssig macht – viele Manager dagegen sind überzeugt, dass Künstliche Intelligenz durch höhere Produktivität Jobs sichern und neue schaffen kann: Zwei Drittel der von Wakefield befragten Manager gehen davon aus, dass Künstliche Intelligenz eher helfe, ihre Belegschaft zu vergrößern.
Sicher ist: Die Arbeitswelt wird sich ändern. Es werden Jobs wegfallen – aber auch neue entstehen. Und viele Arbeitsprozesse werden leichter, indem Mitarbeiter sich ständig wiederholende oder auch gefährliche Aufgaben an Roboter abgeben und sich selbst auf kreative und wertschöpfende Arbeit konzentrieren. „Der Mensch ist nicht zu ersetzen“, stellte Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster kürzlich im Interview mit de.digital klar. „Unsere Wahrnehmung, unsere Sensomotorik ist allen technischen Systemen überlegen. In der Industrie der Zukunft werden Menschen in Teams mit Robotern zusammenarbeiten.“ Wahlster ist Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken – dem weltweit größten Forschungszentrum auf dem Gebiet der KI und deren Anwendungen.
Nicht nur große Konzerne, auch immer mehr kleine Unternehmen, vor allem Start-ups, bieten Dienste an, die auf KI beruhen. Ermöglicht wird das durch einen starken Zuwachs an Cloud-Infrastruktur und der damit einhergehenden Rechenleistung und Vernetzung. Welche Voraussetzungen außerdem gegeben sein müssen, damit KI sinnvoll eingesetzt werden kann, welche Potenziale sie bietet, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Forschungseinrichtungen, Kommunen und vor allem den Menschen, wird derzeit auf der Open-Innovation-Plattform des BMWK öffentlich diskutiert. Hier kann sich jeder beteiligen, der sich mit der Zukunft von vernetztem Denken und Handeln sowie Künstlicher Intelligenz auseinandersetzt.
KI ist auch ein wichtiges Thema im Rahmen der Digital-Hub-Initiative des BMWK. Der Hub in Karlsruhe mit seiner renommierten Tech-Uni KIT widmet sich im Schwerpunkt der Künstlichen Intelligenz und hat bereits einige Start-ups in diesem Bereich hervorgebracht. Und auch der diesjährige Digital-Gipfel der Bundesregierung im Juni in Ludwigshafen beschäftigte sich mit dem Thema: Hierbei ging es unter anderem um verbraucherpolitische Aspekte wie z.B. um Möglichkeiten, Algorithmen durch ein ausreichendes Maß an Nachvollziehbarkeit und Transparenz überprüfbar zu machen.