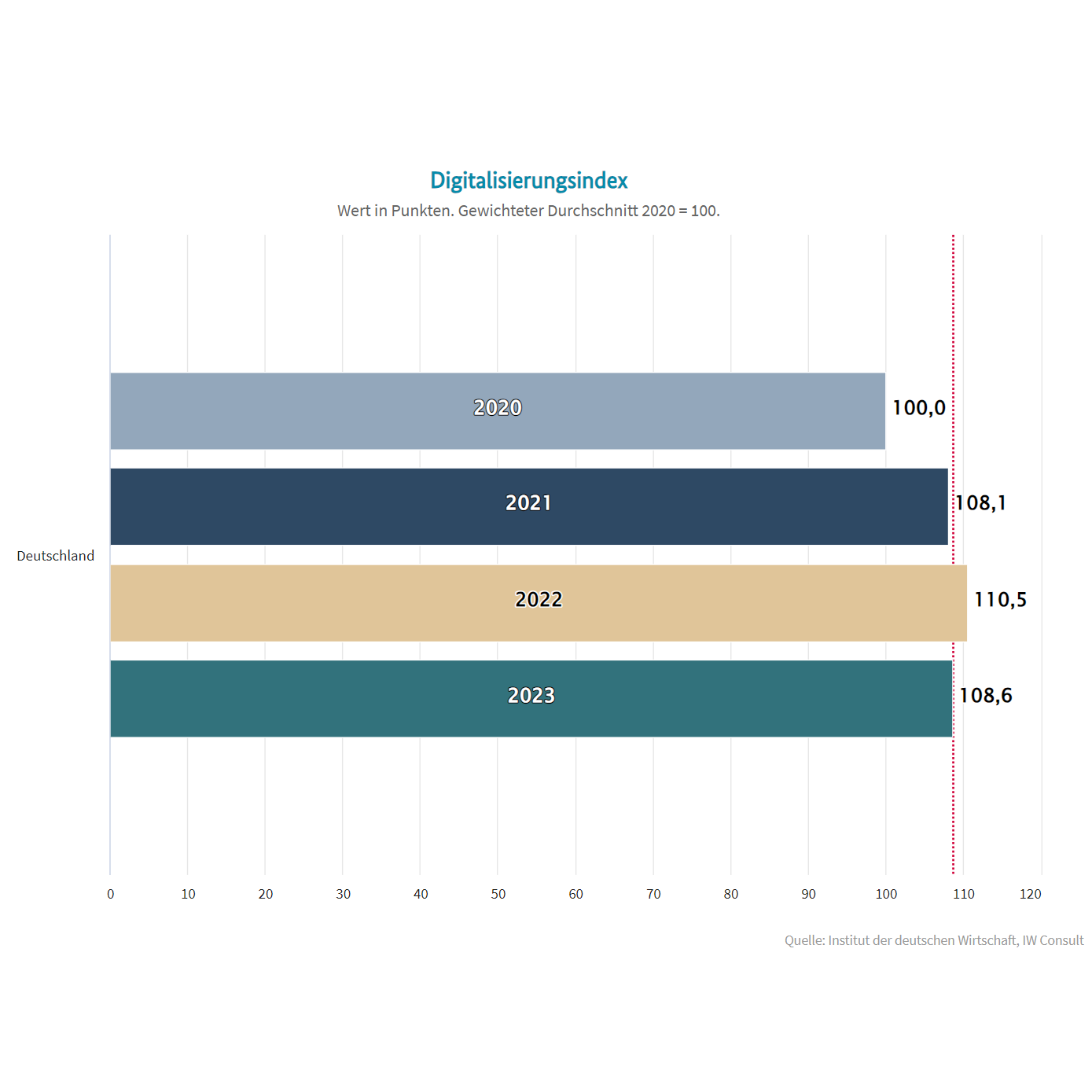© BMWi / Stefan Schacher
Dr. Mathias Hofer von der Leipziger HNO-Universitätsklinik greift zum Endoskop. Das Licht an der Spitze beginnt automatisch zu leuchten, auf einem großen Monitor erscheint das erzeugte Bild, daneben zeigt eine Computerdarstellung das räumliche Verhältnis von Dr. Hofers Arbeitswerkzeug zum Kopf des Patienten auf dem Operationstisch vor ihm. Die Saalbeleuchtung wechselt zu einem gedämpften Blau, um für den 41-jährigen HNO-Chirurgen eine kontrastreiche Arbeitsumgebung zu schaffen – der OP denkt also mit bzw. voraus und passt Lichtverhältnisse und Monitoreinstellungen automatisch an. Hofer führt Endoskop und ein chirurgisches Instrument in das rechte Nasenloch des Patienten ein, die Bildschirme fest im Blick. Die Operation Im Naseninneren des Patienten könnte jetzt beginnen. Doch der ist kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern eine ziemlich realistische Nachbildung aus Kunststoff – im Labor im Innovationszentrum für computerassistierte Chirurgie (ICCAS) an der Universität Leipzig arbeiten Informatiker und Ingenieure Hand in Hand mit Medizinern an der digitalen Zukunft der Chirurgie.
Ein wesentlicher Wunsch, den Hofer und seine Kollegen an die digitale Technik haben, ist eine verbesserte Verfügbarkeit von Informationen: „Man steht im OP am Patienten und möchte während der Operation auf Informationen wie Befunde aus früheren Untersuchungen oder MRT-Bilder zugreifen. Die sind vielleicht in der Papierakte, die ich aus Hygienegründen nicht anfassen darf, oder in unserem Computersystem, vielleicht sogar bei einem anderen Arzt“, erläutert Dr. Hofer, „andere Daten wie Blutdruck und Puls werden bereits auf einem Monitor angezeigt, aber ich kann diesen nicht einsehen.“ Im OP der Zukunft sollen alle verfügbaren Informationen per Sprachsteuerung angefordert und in Echtzeit auf einem zentralen Monitor oder im Okular eines Operationsmikroskops angezeigt werden. „Der Nutzen liegt auf der Hand“, erläutert Dr. Hofer, „der Chirurg und sein Team arbeiten entspannter, die Operationen werden insgesamt kürzer und ganz bestimmt auch besser.“ „Monitore gibt es heute schon in jedem OP“, ergänzt Informatiker Max Rockstroh und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Da werden manchmal dann ausgedruckte Befunde drangeklebt. Wenn ich so etwas sehe, kriege ich als Informatiker erst einmal die Krise. Dann will ich eine bessere Lösung finden.“

© BMWi / Stefan Schacher
„Vom Anfang jeder Idee, jeder Entwicklung an stehen wir Ärzte und Informatiker in engstem Kontakt. Das ist unser großes Plus – anderswo entwickeln Ingenieure Anwendungen in der Hoffnung, dass diese am Ende dann irgendwie in die ärztliche Praxis passen“, erklärt Hofer. Und Rockstroh ergänzt: „Wir entwickeln für den konkreten Anwendungsfall. Zuerst sagen uns die Ärzte, wo bei Ihnen der Schuh drückt, welche Wünsche sie an die Technik haben, beispielsweise die sich automatisch anpassende Arbeitsumgebung oder die Bereitstellung von Informationen während der Operation. Dann kommt eine Phase, in der wir erstmal basteln müssen, und dann holen wir die Ärzte wieder dazu.“ Die Nähe von ICCAS zu den Universitätskliniken im Süden der sächsischen Handelsmetropole erleichtert den Informatikern den Austausch sehr: „Wenn es kurzfristig etwas zu klären gibt, dann können wir einfach den Laptop unter den Arm klemmen und mal eben durch den Friedenspark zur Klinik rübergehen.“
Die Bereitstellung von sehr unterschiedlichen Informationen in Echtzeit ist ein zentraler Wunsch aller Chirurgen. Doch hierfür galt es zunächst, die technischen Grundlagen zu schaffen: „Als das Institut 2005 seine Arbeit aufnahm, war eine der wichtigsten Aufgaben, den Informationsaustausch zwischen der vielfältigen Medizintechnik und der Computersoftware überhaupt erst zu ermöglichen“, erinnert sich Stefan Franke, wie Max Rockstroh Informatiker am ICCAS. „Ohne dass sich die Hersteller der verschiedenen Geräte zusammensetzen mussten, haben wir allgemein gültige Normen und Standards zur technischen Kommunikation entwickelt und gesetzt – in der Frühphase übrigens gefördert aus Projektmitteln des Bundeswirtschaftsministeriums.

© BMWi / Stefan Schacher
Und wann wird der intelligente OP Einzug in die Kliniken halten? „Ich denke ein Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren ist realistisch“, meint Informatiker Rockstroh. „Das hat auch damit zu tun, dass Zulassungsverfahren für medizinische Produkte recht langwierig sind“, ergänzt Hofer, „aber das ist ja auch ein sensibler Bereich. Ausfälle und Fehlfunktionen sind bei medizinischen Geräten natürlich schwerwiegender als beispielsweise bei Toastern oder Kaffeemaschinen.“
Die Digitalisierung des Gesundheitswesen ist eines der Kernthemen beim Digitalgipfel 2017 in der Metropolregion Rhein-Neckar. Als ein anschauliches Beispiel wird die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geleitete Plattform „Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft“ daher den intelligenten OP des Leipziger Forschungsinstituts am 12. und 13. Juni in Ludwigshafen zeigen.